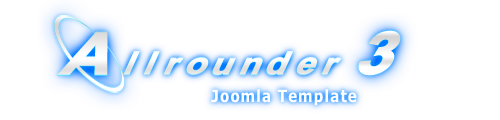Doch vergangene Woche, während der Krisenstab in Berlin auf einen Anruf aus dem Irak wartete, verhandelten im Kölner Hotel Crowne Plaza deutsche und irakische Unternehmer schon wieder über gemeinsame Geschäfte. Grausam sei es, wie die beiden Geiseln Todesängste litten, sagen jene, die im Schutz schwarz gewandeter Sicherheitsleute um Aufträge buhlen. Aber doch wohl ein Einzelfall, der die Sicht auf das große Geschäft nicht verstellen dürfe. »Irak wird ein großer Markt werden«, hatte Bagdads Handelsminister Abdul Basit Karim Maulood im Juli prophezeit. Das Land verfügt über elf Prozent der bekannten Ölreserven, die Mittelschicht ist gut ausgebildet, 24 Milliarden Dollar haben allein die USA für den Wiederaufbau zugesagt. Stromversorgung, Wasser- und Gasleitungen, das Gesundheits- und Telekommunikationssystem müssen ebenso neu errichtet werden wie Verkehrswege, Schulen, Flughäfen. Da möchten auch Deutsche mitmischen. Anfang der achtziger Jahre hatten deutsche Unternehmer noch Waren im Wert von 3,6 Milliarden Euro in Saddam Husseins Reich geliefert. 2005 betrug die Exportquote weniger als ein Zehntel. Regelmäßige Kontakte mit dem Irak pflegten noch 30 bis 40 Firmen. Doch alle hoffen auf den Aufbruch im Norden. Im vergleichsweise sicheren kurdischen Teil des Landes sind Deutsche hochwillkommen, trotz der technischen Unterstützung für Saddam Husseins Giftgasfabriken.
So bilden denn Kurden auch die Mehrheit der Konferenzteilnehmer hier in Köln. Ein dunkelblauer Anzug reiht sich an den anderen, dicke Schnurrbärte, dunkle Augen, Drängen, Schieben, Lachen, Zigarettenqualm, dazwischen Hermann Josef Brauns. Er baut Anlagen für die Nachrichtentechnik von Fernsehsendern. »Wir werden doch dazu gezwungen, neue Märkte zu erschließen«, sagt Brauns, »da geht es um das nackte Überleben.« Gleich trifft er Offizielle des kurdischen Fernsehens. Deren Auftrag könnte millionenschwer werden. Dann muss er hin, um die Anlage aufzubauen. Und mit ihm seine Mitarbeiter.
Brauns Angst weicht der Zuversicht, die der Midan-Club verbreitet. Sein Mantra: Der Irak ist für Geschäftsleute sicher. Midan will exportwilligen Deutschen Partner vermitteln, die deren Transaktionen im Land abwickeln. Wenn nötig, stellt die Vereinigung gegen Bezahlung auch Kontaktleute und Sicherheitsexperten für Reisen in den lebensgefährlichen Zentralirak. Dafür erntet sie auch Schelte. Der ehemalige grüne Landtagsabgeordnete Siggi Martsch â er vermittelt im kurdischen Erbil Aufträge an Deutsche â findet die gefährliche Geschäftsvermittlung jedenfalls verantwortungslos: »Wer als Deutscher von Kurdistan aus die innerirakische Grenze nach Süden überschreitet, begibt sich auf ein Himmelfahrtskommando.«
So denkt wohl auch mancher deutsche Politiker. Während die entführten Ingenieure noch vor den Gewehrläufen der Fundamentalisten knien, fordern einige schon, den Leipziger Chef der Entführten an den Kosten für den Krisenstab zu beteiligen. Unternehmer, die sich dieser Tage im Irak engagieren, so scheint es, gelten nur noch als lebensmüde Abenteurer. Die Politik hat das freilich nicht immer so gesehen. Schon im Dezember 2004 versprach Bundeskanzler Gerhard Schröder dem damaligen irakischen Übergangspremier Ijad Allawi »eine intensive Beteiligung deutscher Firmen am Wiederaufbau«. Vergangenen Juli verkündete der damalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD), er »erwarte, dass die deutsche Wirtschaft auch im eigenen Interesse pragmatische Lösungen entwickelt, mit denen sie den Wiederaufbau voranbringen kann«. Bei einer deutsch-irakischen Wirtschaftskonferenz im Sommer lobte auch der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber das »Interesse der deutschen Wirtschaft am Wiederaufbau«. Als eines der ersten OECD-Länder schloss Deutschland im November mit dem Irak ein Rahmenabkommen über staatliche Exportkreditgarantien. Diese Hermes-Bürgschaften sollen deutschen Unternehmen das finanzielle Risiko solcher Geschäfte absichern. Mehrere Unternehmen haben bereits Bürgschaften beantragt, doch der für die Vergabe letztlich entscheidende interministerielle Ausschuss hat sich noch nicht abschließend dazu geäußert. Wirtschaftsminister Michael Glos (CSU) rühmt dennoch den Einsatz der entführten Ingenieure. Wer wie Deutschland Exportweltmeister sei, komme nicht ohne solche Leute aus.
Ein Widerspruch zu den Reisewarnungen, die das Außenministerium in regelmäßigen Abständen herausgibt? »Nein, keineswegs«, sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Auch ihr Ministerium bekenne sich ja zum politischen und wirtschaftlichen Aufbau und der damit erhofften Stabilisierung. Deutsche Unternehmen sollen sich engagieren, aber eben nur »soweit es die Sicherheit zulässt«. In anderen Worten: Wird es zu gefährlich, sollen nicht deutsche Techniker in gepanzerten Wagen durch die Gegend rasen, sondern irakische Ingenieure die Leitung übernehmen, die â von Regierung und Industrie gefördert â in Deutschland ausgebildet werden.
Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Nur spricht das niemand gerne aus, auch in Köln nicht. »Die Geschäfte laufen gut. Wir sind schon seit 1974 dort. Auch während des irakisch-iranischen Kriegs und des Embargos. Kurz nicht, als die Amerikaner kamen.« Matthias Weber vertritt MG International Transport. Die Siegener Spedition bringt Waren aus der ganzen Welt in den Nahen Osten. In Amman residiert der deutsche Regionalbeauftragte, Büros gibt es überall in der Region, auch in Bagdad und Basra.
Und er selbst? Weber lächelt. Wenn man Schiffsladungen organisiert, muss man selbst dabei sein, sagt er. Wie weit gehen Sie? Bis zur Grenze, da ist viel zu regeln. Was ist mit Bagdad? Bis zum Flughafen, vielleicht. Schnell rein, schnell raus. Was tun Sie zu ihrer Sicherheit? Nicht auffallen. Wie geht das? Lächeln. Werden Sie geschützt? Noch ein Lächeln. Und ihre irakischen Mitarbeiter? Keine Adressen, keine Namen. »Es ist ein Vabanquespiel. Wenn irgendjemand merkt, dass ein Araber für eine ausländische Firma arbeitet, ist der gefährdet.« Kennt er andere deutsche Geschäftsleute, die dort aktiv sind? Man begegnet schon vielen. Was er davon hält? Ein letztes Lächeln.
Mitarbeit: Klaus-Peter Schmid
DIE ZEIT 09.02.2006 Nr.7
07/2006